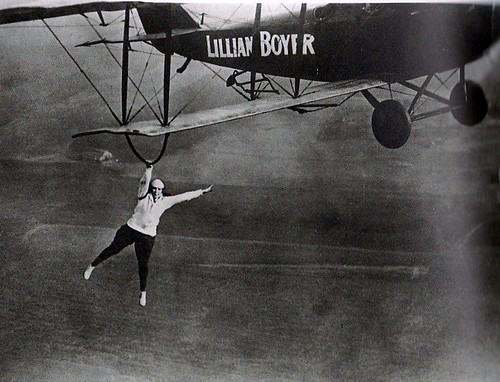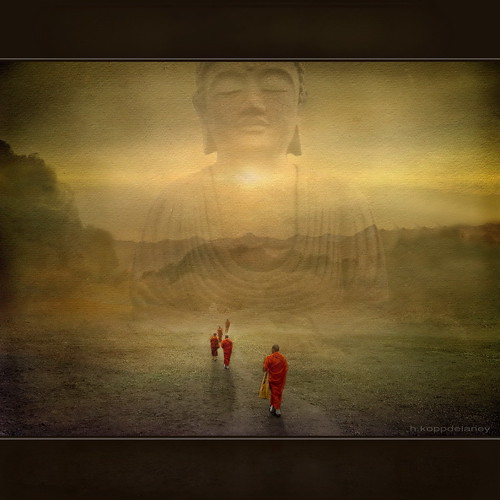Im letzten Beitrag hatte ich mich ja zu den dubiosen Kehrseiten und Grenzen des Schnelllesens ge√§u√üert. Diesen verquasten Theorien von Menschen im Selbststeigerungswahn fehlt die Skepsis der Philosophie. Eine philosophische Wissenschaftstheorie w√ľrde der gesamten Gesellschaft nicht schaden und ich wundere mich, dass dies in der Schule keine Rolle spielt. Derweil beschr√§nken sich die Menschen auf den Austausch von Argumenten, w√§hrend die philosophische Wertung dieser Argumente in Bezug auf das Ganze mehr bringen w√ľrde. Genau dann w√ľrde nicht viel √ľbrig bleiben von den meisten Heilsversprechen der Speedreader und Mental Coaches. Obwohl ich aber auch aus Erfahrung den meisten Schnellleseversprechen skeptisch gegen√ľber stehe, stellt sich mir dennoch die Frage, ob es im Gehirn Hebel gibt, die einfach umgestellt, alte Grenzen des Geistes √ľberwinden lassen. Ist es m√∂glich sein Gehirn zu tunen oder wie einen Muskel zu trainieren?
Nun im Bereich des Schnelllesens gibt es zumindest Menschen, die zu außergewöhnlichen Leistungen in der Lage sind. Der Verdacht liegt nah, dass nicht nur Kim Peak, sondern tendenziell auch andere Menschen in der Lage sind, dieses zu erlernen. So wie eine philosophische Grundeinstellung oder das Klavierspiel durch Übung möglich sind, sollten doch andere Grenzleistungen möglich sein. Klären wir also mal zum Schnelllesen ein paar Fragen
Kann mit Schnelllesetechniken auch ein philosophisch schweres Buch vernascht werden?
Mit einer Geschwindigkeit von 10.000 Wörtern pro Minute kann dieses nicht möglich sein, es sei denn derjenige besitzt hinzukommend noch ein außergewöhnliches Maß an Intelligenz. Der reine Lesevorgang bedeutet ja nicht, dass wir damit schon verstanden hätten. Wohl aber stellt die meiste Belletristik mit ihrer Redundanz, das heißt der beständigen Wiederholung derselben Gedanken eine Unterforderung dar, so dass es vorstellbar ist, diese mit hoher Geschwindigkeit aufzunehmen. Bei der Philosophie hingegen bedarf es eines Höchstmaßes an genauem Überlegen als auch der entsprechend philosophischen Wertung der Gedanken. Das reine Lesen eines philosophischen Werkes ist daher keine Vermehrung von Wissen, sondern Zeitverschwendung.
An dieser Stelle kann sogleich auch mit dem Mythos aufger√§umt werden, das Wissen eine blo√üe Aufnahme von Daten w√§re. Gut, das ist den meisten hier schon bekannt, es kommt philosophisch betrachtet allerdings auch darauf an, einen Gegenbegriff in Bezug auf das Ganze zu entwickeln. Ein moderner Wissensbegriff wurde von dem Linguisten Gerd Antos aus Halle entwickelt. F√ľr alle die dieser Wissensbegriff in seiner groben Konzeption interessiert habe ich diesen auf meinem Philosophieblog „Fahrenheit“ hinterlegt.
Es sei hier soviel gesagt, dass ihr mit viel Lesen meines Erachtens nicht intelligenter oder weiser werdet. Die Verkn√ľpfung des Gelesenen zu eigenen Texten ist f√ľr mich als Philosophen das entscheidende Kriterium. Daher ist das Thema des Schnelllesens wohl auch nur f√ľr Menschen geeignet, die sich schnell √úberblicke verschaffen m√ľssen. Einer gesamtphilosophische¬†Sicht ist damit allerdings nicht erreicht. Genauer bedacht kann ich aber das schnelle Lesen wohl helfen, √ľberfl√ľssige Literatur schnell zu selektieren. Hier aber kommen wir eher zum Thema Leseeffizienz.
Wie schnell kann ich lesen?
Die Lesegeschwindigkeiten m√ľssten genauer in einem Range angeben werden. Mein Range betr√§gt derzeit 30-1000 W√∂rter pro Minute. Bei philosophischer Literatur lese ich extrem langsam, obwohl es zumeist auch sehr lohnend ist, bei nicht-philosophischer Literatur, wo ich den Bereich von 1000 W√∂rtern pro Minute vordringe, h√§tte ich mir die Lekt√ľre zumeist auch sparen k√∂nnen. Dies ist aber vielf√§ltig von meinen Interessen abh√§ngig. F√ľr einen Germanistikstudenten mit Schwerpunkt auf Deutsche Literatur kann es sehr sinnvoll sein, sich bestimmte einfache Literatur schnell reinzuziehen.
Wie teuer sind solche Seminare?
Nach etwas √§lteren Recherchen entsinne ich mich auf einen Preis von 12.000 Euro f√ľr verschiedene Trainingstreffen und telefonisches Coaching √ľber einen Zeitraum von 6 Monaten. Ich erz√§hle dies allerdings nur aus der Erinnerung. F√ľr Autodidakten lautet die schlechte Nachricht, dass sie Grenzen √ľber 1000 W√∂rtern pro Minute nicht erreichen werden, da eine ganz andere Art zu lesen erlernt werden muss. So geben auch die Michelmanns einen qualitativen Sprung von 1000 WpM zu 6000 an. Bis 1000 W√∂rter pro Minute k√∂nnt ihr euch mit den alten Techniken M√∂glichkeiten maximal steigern. F√ľr Geschwindigkeiten von 4000 W√∂rtern pro Minute ist allerdings eine ganz andere Technik n√∂tig. Der Lernprozess ist sehr aufw√§ndig, da ihr erstmal Text lest, aber nichts versteht. Der Trainer achtet dann darauf, ob ihr alle Bewegungen richtig durchf√ľhrt, die Augen werden beispielsweise mit speziellen Videokameras abgefilmt. Es kommt darauf an, zun√§chst nur die Bewegungen zu verinnerlichen und dies √ľber einen langen Zeitraum.
Bei einer kleinen Stichprobe deren Auswertung ich entdecken konnte, betrug die Erfolgsquote allerdings auch nur um die 15%. Das hei√üt es ist eine hohe Risikoinvestition mit einer fragw√ľrdigen Gewinnaussch√ľttung. Vielleicht kauft ihr euch lieber einen Kleinwagen, um eure Zeit bei √∂ffentlichen Verkehrsmitteln zu sparen?
Zweit√§gige Seminare mit mehreren Teilnehmern zum simplen Geschwindigkeitssteigern kostet ca. 100 Euro. Diese Techniken k√∂nnt ihr allerdings autodidaktisch erwerben, was f√ľr viele immerhin noch eine 2 bis 4-fache Zeitersparnis bedeutet. Habt ihr fr√ľher ein Buch in einer Stunde gelesen, so k√∂nnt ihr es dann in 15 Minuten. Zudem nehmt ihr die Inhalte besser und nachhaltiger auf. Wie gesagt f√ľr komplexe Stoffe gilt aber vor allem langsames und verstehendes Lesen.
Wo finde ich echtes Schnelllesen?
„Es ist, als ob mein Gehirn seinen Turbolader eingeschaltet hat – und das nicht nur beim Lesen! Ich kann jedem nur empfehlen, eins der Seminare mitzumachen! Man lernt mit Leichtigkeit und viel Spa√ü – eben gehirngerecht.“
Die Michelmanns sind wohl die erfahrensten Trainer im Schnelllesen, allerdings m√∂chte ich mich auch nicht f√ľr diese Seite verb√ľrgen. Dar√ľberhinaus ist die Seite der Deutschen Gesellschaft f√ľr Schnelllesen wohl eine erste Anlaufstelle.
Was bringt Schnelllesen f√ľr anspruchsvolle Projekte wie Philosophie?
Eine Philosophie des Schnelllesens kann es in der Philosophie selbst nicht geben. Die Lesegeschwindigkeit ist hier nicht steigerbar, sondern immer abh√§ngig von der Geschwindigkeit des Verstehens. W√§hrend wir von Bellestristik oder simpler technischer Literatur in der Regel selbst noch mit Geschwindigkeiten von 20.000 W√∂rtern pro Minute unterfordert w√§ren, so √ľberfordert eine Seite des Philosophen Kant den Verstand auf Jahre hinaus. Dies h√§ngt vor allem damit zusammen, dass wir in der Philosophie nicht hier oder dort √ľber ein Problem sprechen, sondern das Ganze in seinen Grenzen versuchen zu denken. Schnelllesen mag uns dabei helfen, sinnvolle von sinnloser Literatur schnell zu trennen, die Grenze dieser Unterscheidung legt aber das Denken mit seiner Zielorientierung auf die Vernunft und dies ist die Geschwindigkeit der Philosophie. Die Philosophie ist damit die Konstante, zu der sich all unser Denken in seiner m√∂glichen Geschwindigkeit verh√§lt.
Vielen Dank Norman Schultz.